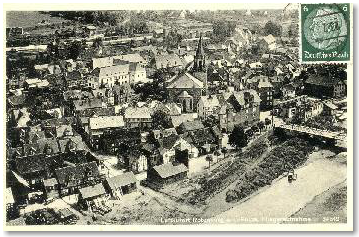Das zerstörte Möbel und anderes Raubgut aus dem Besitz der jüdischen Familien wurde in die Sandgruben am Wittich gefahren und dort zu Scheiterhaufen aufgetürmt. „Man konnte in unserem Gartenhäuschen in der Braacher Straße Zeitung lesen“, beschreibt ein Zeitzeuge, damals 14 Jahre alt, das Ausmaß des von den Beteiligten als Freudenfeuer apostrophierten Vernichtungswerkes.
Ein zweiter Sammelplatz zum Verbrennen der Einrichtungsgegenstände aus den jüdischen Geschäftslokalen und Privathäusern war auf dem Gelände hinter der neuen Fuldabrücke.
Eine damals Zwölfjährige: "Wir Kinder sind mitgelaufen als die ganzen Sachen von den Juden am Fuldaufer der Altstadt verbrannt worden sind. Der R. hat dann gerufen: Wenn keiner das Feuer anzünden will, dann tue ich das: das Freudenfeuer von Rotenburg! - und dann haben sie den Leuten das ganze Zeug verbrannt."
Ein damals 13-Jähriger: "Die Wärme von den brennenden Möbeln konnte man bis auf die alte Brücke spüren, wo die Leute am Abend standen und sich das beguckten."
In einem sieben Jahre danach verfassten Kirchenbucheintrag weist Pfarrer Hammann in eine andere Richtung: „In dem Feuerschein kündigte sich für viele hellsichtige, stille Beobachter der Brand eines neuen Krieges an. ,Das ist der Anfang des Endes dieses Reiches`, so sprachen es viele Menschen heimlich einander zu.“