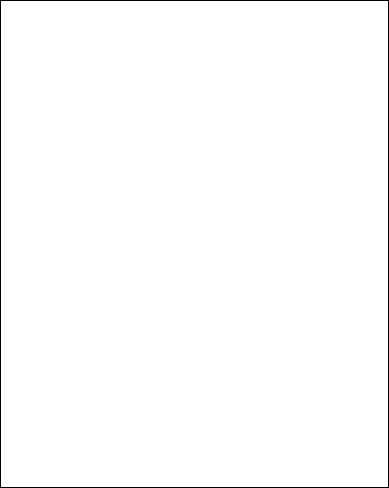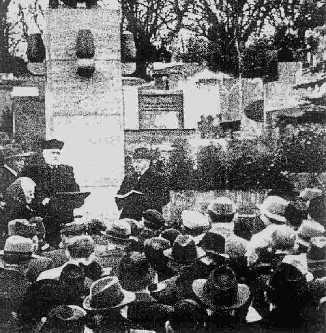Neuhaus bekam in Frankfurt bald Probleme mit der großen
Zahl der aus Osteuropa stammenden Juden, hauptsächlich
Displaced Persons, deren Mentalität ihm fremd blieb.
Cilly Kugelmann sieht ihn als denjenigen, der für die
Kontinuität der Frankfurter jüdischen Vorkriegsgemeinde
nach Kriegsende stand. Als Frankfurter Rabbiner bis August
1942 im Amt stellte er eine Verbindung zu ihrer
Vergangenheit her - allerdings nur noch für sehr wenige
Menschen,. Das Interesse an religiöser Praxis - so Cilly
Kugelmann - war bei den Überlebenden wenig ausgeprägt.
Dies mochte - angesichts der schlechten Versorgungslage
mit spärlichen Lebensmittelrationen und kaum
vorhandenem Wohnraum - an dem täglichen Kampf ums
Überleben liegen. Hinzu kam, dass viele Juden ihren
Aufenthalt in Deutschland als zeitlich eng begrenzt ansahen,
sozusagen auf gepackten Koffern saßen.
Rabbiner Leopold Neuhaus hatte Schwierigkeiten, die
religionsgesetzlich erforderliche Mindestzahl von zehn
Männern (Minjan) für einen Gottesdienst
zusammenzubringen.
Vergeblich bemühte sich Leopold Neuhaus darum, das
durch deutsche Behörden und die Gestapo beschlagnahmte
Vermögen der deportierten Frankfurter Juden ausfindig zu
machen und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen.
Angeblich oder tatsächlich waren die Dokumente, die
dafür nötig waren, durch die Kriegsereignisse zerstört oder
durch die Täter vernichtet worden.
Die schwierigste und letztlich nicht lösbare Aufgabe für
Neuhaus war - so Cilly Kugelmann - die Lösung der
Probleme, die in Zusammenhang mit den Displaced
Persons standen: "Neuhaus' negative Reaktion auf die
Displaced Persons geht wohl in erster Linie auf die
katastrophale Versorgung zurück, die kaum für die ihm
unterstellten deutschen Juden ausreichte.(...) Sein
Pflichtgefühl gegenüber den Frankfurter Überlenden zwang
ihn dazu, die Zeit bis zu seiner Auswanderung zu nutzen,
um ihre Lage wenigstens graduell zu erleichtern. In der
konkreten Arbeit kämpfte er gegen ineffiziente deutsche
Behörden und hatte sich gegen Vorwürfe von jüdischen
Querulanten zu verteidigen. So beklagte er sich
beispielsweise erbittert über nicht erfüllte Zusagen zur
Lieferung von Hilfsgütern bei den Behörden, wie einem Brief
vom 4. Oktober 1945 zu entnehmen ist:
"In den Wohnungen und Kleiderschränken der Nazi-Aktivisten wird sich noch unendlich viel den Juden
gestohlenes Gut an Möbeln, Silber, Kleidung und
Wäsche vorfinden. Aus welchen moralischen Gedanken
heraus sollen sich die so schwer geschädigten Juden,
welche alle Güter des geistigen, kulturellen und sozialen
Lebens entbehren, mit dem Primitivsten zufrieden
geben? Bei allem guten Wollen der Stadtverwaltung, das
unverkennbar vorhanden ist, bleibt doch die Lücke
zwischen Theorie und Praxis."
Im Februar 1946 beklagt er in einem Brief an einen
Freund, daß sich "manche Juden dazu hergeben,
früheren Nazis Bescheinigungern zu geben, um sie
reinzuwaschen. Diese Scheine werden hier im
Volksmund 'Persilscheine' genannt. Wir gehen gegen
diese Menschen mit allen Mitteln vor, welche nicht
daran denken, daß 6 Millionen Juden von den Genossen,
denen sie die Bescheinigungen ausstellen, ermordet
wurden."
Er konnte sich nur schwer damit abfinden, dass die
ehemaligen Nazis nur vorübergehend weggetaucht waren.
„Wir haben (...) die Absicht, sobald wie es möglich ist,
zu unseren Kindern nach New York auszuwandern.
Auf keinen Fall bleiben wir hier in Frankfurt/M., um mit
Nazis weiter dieselbe Luft zu atmen“, hatte er
bereits am 5.11.1945 in einem Brief kundgetan. Mitte Juni
1946 wanderten Leopold Neuhaus und seine Frau Cilly in
die USA aus. In Detroit (Michigan) übernahm er eine
Rabbinerstelle in einer Gemeinde, die 1941 von Juden aus
Süddeutschland gegründet worden war.
Leopold Neuhaus bei der Einweihung eines
Mahnmals auf dem jüdischen Friedhof in
Würzburg am 11. November 1945
Auch über die hessische Landesgrenze hinaus war
Leopold Neuhaus wichtig für den Wiederbeginn
jüdischen Lebens im Nachkriegsdeutschland. Als die
nach Würzburg zurückgekehrten überlebenden
Juden am 11. November 1945 auf dem dortigen
Friedhof ein Mahnmal einweihten, war es Leopold
Neuhaus, der die Weiherede hielt.